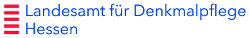Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Kirchweg 1
Teil der Gesamtanlage:
Eichelsachsen
An Stelle einer älteren Kirche wurde das bestehende Gotteshaus 1722/23 im Zentrum des unteren Dorfbereichs errichtet. Es entstand als geosteter Saalbau in einer für jene Zeit bemerkenswerten Kombination aus Fachwerk und Massivbau. Der kurze Westabschnitt der Kirche ist gemauert und verputzt und mit Eckquaderung und profiliertem rundbogigem Portal versehen. Oberhalb des Portals nennt ein Stein das Baujahr, darüber öffnet ein Rechteckfenster die Wand. Der schieferverkleidete Westgiebel ist mit einem kräftigen Krüppelwalm versehen. Über dem gemauerten Bauabschnitt trägt das Dach den achtseitigen, mit gestaffelter geschweifter Haube abschließenden Dachreiter. Dieser dürfte die Ursache für den massiv ausgeführten Westteil der Kirche sein, gab es bei den Fachwerkkirchen doch immer wieder Probleme mit der Tragfähigkeit der Unterkonstruktionen der "Türme". Der wesentliche, östliche Teil des Kirchengebäudes entstand als Fachwerkkonstruktion mit dreiseitigem Schluss. Das Balkenwerk wurde 1961 freigelegt: Zwischen bis zur Traufe durchgehenden Wand- und Eckständern ist das Gefüge quasi "zweigeschossig" durch kräftig ausgebildete ganze und halbe Mann-Figuren verstrebt. Sie sind mit Halsriegeln und (an den Hauptansichtsseiten gekehlten) Kopfwinkelhölzern ausgebildet. Die rund- oder segmentbogigen Fenster sind unregelmäßig eingesetzt und stammen wohl aus zwei Phasen. An der Südwand, die als Schauseite ausgebildet ist, treten sie gekuppelt auf und werden teilweise durch schlanke gedrehte Halbsäulen gerahmt. Auch das hier angeordnete Hauptportal steht zwischen freilich kräftiger in Erscheinung tretenden Halbsäulen mit korinthisierenden Kapitellen und Gebälkansätzen mit Blütenmotiven. Sie tragen ein kleines Vordach. Das Innere hat an Süd-, West- und Nordseite sowie im Chor Emporen auf meist säulenartigen Holzstützen. An der Innenseite der Emporenbrüstung blieben feine Signaturen wohl von Bauhandwerkern mit den Jahreszahlen 1722 und 1723 erhalten. Die Emporen wurden 1802 an der Südseite sowie um ein oberes Geschoss im Westen erweitert. Entsprechend sind unterschiedliche Gruppen von Bildern an den Emporenbrüstungen zu sehen. An der Orgelempore im Chor (die Orgel mit einem Rundbogenprospekt stammt aus 1872 und wurde von der Firma Förster in Lich hergestellt) erscheinen eine Ölbergszene und bemerkenswerterweise ein Vogel Phönix auf seinem Nest in wilder Landschaft. Daneben befindet sich ein jüngeres Lutherbild. Vor den anderen Emporen sind ganzfigurige, teilweise 1932 stark erneuerte Darstellungen Christi, der Evangelisten, Apostel und Luthers mit dem Schwan, jeweils in angedeuteten Nischen sitzend oder stehend gemalt. An der Seite der Südempore existieren zwei Bilder aus dem 19. Jahrhundert, die Flucht nach Ägypten und die Auferstehung schildernd. Zu dieser Gruppe dürfte ein separat aufbewahrtes Gemälde mit der Taufe im Jordan gehören. Die flache Decke des Kirchenraums hat zu beiden Seiten eines Längsunterzugs geometrische Stuckfelder aus dem 19. Jahrhundert. Der Chor wird durch einen breiten Bogen abgetrennt, in dessen Scheitel das Relief eines Kopfs eingespannt ist. Der Chor hat ein flaches hölzernes "Rippengewölbe", die Rippen gehen von einem doppelten, ornamentierten "Schlussstein" aus und erreichen teilweise Wandvorlagen oder enden auch über den Chorfenstern. Im Gewölbescheitel ist ein seine Jungen atzender Pelikan angebracht. Dem Chorpolygon folgt eine Loge mit Holzgittern. An der Südseite des Chorbogens steht die Kanzel über einem Pfosten. Sie stammt aus der Bauzeit, wird durch gedrehte Säulchen mit korinthisierenden Kapitellen gegliedert und zeigt gemalte Bilder der Evangelisten. Einen Schalldeckel gibt es nicht. Das Altarkruzifix mit Evangelistensymbolen an den Balkenenden stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert; zu seinen Seiten stützen gedrehte Holzsäulen die Orgelempore. Zur Ausstattung der Kirche gehört der Torso eines spätbarocken Taufengels. Auf dem mit niedriger Basaltmauer eingefassten Kirchhof blieben fünf Grabmäler erhalten, die teilweise (als Erinnerung an die mit Eichelsachsen verbundene Forstgeschichte) von besonderer orts- und auch kunstgeschichtlicher Bedeutung sind: Grabstein zweier Geschwister, die beide im Kindesalter 1733 starben. Die Stele hat eine traditionelle ländlich-barocke Form, der Oberteil mit Darstellung zweier Personen ist großenteils abgebrochen. DAHIER IN DIESER GRUFT / RUHET BIS IESUS RUFT / DIE HOCHWOHLGEBOHRNE FRAU / FRAU VON KRUSSE / GEBOHRNE VON BAERNER / AUS DEM HOCHADELICHEN HAUS KRESSIN / IN MECKLENBURG / GEBOHREN 1661 DEN 19. TAG MAY / GESTORBEN 1736 DEN 28. TAG JULII / PSALM 73 V 25,26 [...]. Hochrechteckiger Stein in der Art einer Grabplatte mit erhabenem Profilrahmen; über der Inschrift eine Wappenkartusche mit Helmzier, in den unteren Ecken Akanthusblätter. Hochformatige Stele mit geschweiftem Abschluss, darin geflügelter Engelskopf. "All hier / Hat ihre Ruhe Statt / Frau Elisabetha eine geb. Schmittin / sie war gebohren 1716 / und trat in die Ehe 1738 / mit He. Johannes Weber / Hoch Fürstlicher ver walter allhier / sie lebte in der Ehe 19 Jahr / als eine einsame Witwe [...] 22 Jar / und starb [den] 26 Sept 1779 / Ihres Alters 64 Jahre [...]". Mächtige Vase beziehungsweise Urne auf kubischem Postament, dessen Flächen von Girlanden gerahmt werden. Die Inschrift unterhalb einer Wappendarstellung lautet: "Johann Christian Haberkorn / Fürstlich Hessen Darmstädtischer / Regierungs Secretarius und / Forstverwalter / gebohren in Grünberg d. XXII. / Merz MDCCXL / gestorben in Eichelsachsen d. VII Sept. / MDCCLXXXVIII / Ein treuer Diener und Menschen Freund / Hier ruhet er sanft." Sowohl Wappen wie Zopfstil-Ornamentik und Größe des Grabmals vermitteln aristokratischen Anspruch. Hochformatige Stele mit zwischen Voluten eingezogenem, flachbogigem Abschluss. Oben Relief eines Hirschs vor einem Baum und einer geflügelten Kugel. Grabmal für Oberförster Johann Görg und seine Ehefrau, die Inschrift leider kaum lesbar, zweite Hälfte 18. Jahrhundert. Weiter steht auf dem Kirchhof das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Es ist aus rotem Sandstein und hat die Grundform eines vierseitigen Pfeilers mit sich nach oben verbreiterndem glattem Kapitell, aus dem eine Flamme emporlodert, und dessen Vorderseite das Relief eines Soldatenkopfes mit Helm zeigt. Auf der Pfeilerfront erhabene Inschrift und Schwert, rückwärts ein Hessenlöwe. Zu beiden Seiten sind dem Pfeiler geschweift abschließende Inschriftplatten angesetzt, sie zeigen oberhalb der Namen der Gefallenen geflügelte Engelköpfe. Die Grabsteine und das Erinnerungsmal sind Kulturdenkmäler aus geschichtlichen und künstlerischen, die Kirche außerdem aus städtebaulichen Gründen.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |