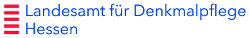Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Gesamtanlage Historischer Ortskern
Die Burg Beilstein liegt auf einem Basaltfelsen im oberen Ulmbachtal. Der Ort schließt sich nördlich und östlich auf beiden Seiten des Ulmbachs an. Die Burg ist seit 1129 als Sitz der Herren von Beilstein bekannt. Ihre landesherrschaftliche Stellung erwarben sie sich als Wormsische Vögte des Kalenberger Zents. In der 1. Hälfte des 13. Jhs. wurden sie von den nassauischen Grafen verdrängt und mussten sich auf die Burgen Lichtenstein und Greifenstein zurückziehen. Die neuen Landesherren errichteten in der 1. Hälfte des 14. Jhs. die heute als Ruine erhaltene Kernburg. In diese Zeit fiel auch die Verleihung der Stadtrechte an Beilstein. Sie erfolgte 1321, ohne dass eine städtische Entwicklung einsetzte. Beilstein wurde zum Sitz zweier nassauischer Nebenlinien, von denen die jüngere, 1607 durch Graf Georg begründete, von besonderer Bedeutung für Beilstein war. Graf Georg residierte in Beilstein; das gemeindliche Leben verlagerte sich von Wallendorf nach Beilstein. In seine Herrschaftszeit fiel die Errichtung der Schlosskirche und des neuen Torbaus auf dem südöstlichen Burggelände. Bereits 1620 kam diese Entwicklung mit der Residenzverlegung des nassau-beilsteinischen Hauses nach Dillenburg wieder zum Erliegen. Auf der Burg verblieb lediglich die Amtsverwaltung in dem neu errichteten Torbau. Die übrigen Bauten der Burg wurden dem Verfall überlassen. Die Gesamtanlage Beilstein umfasst den Burgbereich mit Schlosskirche und den nördlich und östlich sich anschließenden Ortskern. Beilstein zeigt das typische Bild einer an einen im Kern mittelalterlichen Herrschaftssitz sich anlehnenden kleinen Siedlung. Die Bedeutung der Gesamtanlage liegt auf territorialgeschichtlichem und siedlungsgeschichtlichem Feld.
Als Gesamtanlage nach § 2 Absatz 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |