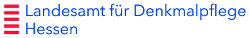Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Kloster Mariahausen
Die Zisterzienserinnengründung des 12. Jhs. fand 1189 erstmals Erwähnung als ulinhusin oder Husen mit dem zugehörigen Ort Aulhausen. Zu den Anfängen existieren unterschiedliche Angaben: Als Gründer bzw. Stifter werden sowohl der Mainzer Vitztum Konrad von Rüdesheim, sein Sohn Giselbert, Vogt über das Kloster bis 1189, als auch Adelige aus Lorch genannt. Die Klosterkirche wurde 1219 geweiht, jedoch erst später vollendet. Ab Mitte des 15. Jhs. nannte sich das Kloster Mariaehausen. Nach Zeiten der Armut und Zerstörung um 1660 neu aufgebaut, gelangte es um die Mitte des 18. Jhs. zur Blüte, verbunden mit Erweiterung und weitgehender Erneuerung der Klostergebäude unter Äbtissin Maria Anna Kreppelin (1743-1793). Nach Säkularisation und Aufhebung des Klosters 1810/11 Veräußerung der Gebäude an den Freiherrn von Zwierlein und Nutzung als Ökonomiehof. 1887 Rückkauf durch Bischof Blum für die Diözese Limburg und Umwandlung in eine Diözesan-Rettungsanstalt, später Knabenheim. 1915 Zerstörung durch Brand, Wiederaufbau ohne Ostflügel bis 1925. 1924 Jugendheim der Salesianer Don Boscos, 1939 zeitweise Enteignung durch die NSDAP und Umwandlung in einen „Lehrhof" unter Verlust zahlreicher bis dahin noch vorhandener Kunstwerke. Seit 1991 Übernahme der Anstalt durch das St. Vinzenzstift Aulhausen.
Aus der Zeit vor dem Brand existieren eingehende Beschreibungen von Lotz (1880) und Luthmer (1907) über den früheren Zustand und nicht erhaltene Einzelheiten. Vom einst reichgegliederten Ostflügel mit Fachwerkgiebeln in geschweiften Renaissanceformen über dem spitzbogigen Kreuzgang blieb nur eine Ruine, die später abgebrochen wurde. „Der östliche Flügel, worin jetzt Stallungen, gothisch, enthält einen grossen Raum mit gothischen Ständern und Knaggen. Aussen neben dem Chorhaupt ein arg verstümmeltes Portal, ehemals mit Masswerk am Bogen, an der Langseite schmale rechteckige Fenster mit gothischer Profilirung. Der östliche Flügel des Kreuzgangs, gothisch, jedoch 1752 umgestaltet, hat noch spitzbogige Fenster und gothische Fussbodenfliessen." (Lotz). Im Westflügel des Klosters geschnitztes Treppengeländer des 18. Jhs. Im Saal des Obergeschosses reich geschnitztes barockes Sprechgitter und dekorierte Ofennische. Eine farbige Ledertapete war 1907 nicht mehr vorhanden. Auf dem First ehemals schmiedeeiserne Windfahnen des 18. Jhs. An Ausstattungsteilen der Kirche werden u. a. beschrieben: Eine halbkreisförmig gebogene Bretterdecke im Chor in Form eines Klostergewölbes. Zwei Altäre mit romanischen Säulchen, ein gotisches Wandtabernakel, ein Wandschrank mit gotischen Beschlägen, eine gotische Holzfigur St. Margaretha, eine Diakonfigur mit Pulttafel (lectorile; im Museum Limburg). Die zuletzt als Abstellraum genutzte, um 1975-80 abgebrochene Totenkapelle des 17. Jhs. mit Walmdach und kleinem Dachreiter enthielt früher zwei gotische Figuren und gotische Bodenfliesen.
Lage des ehemaligen Klosterkomplexes am Nordrand des Dorfes auf der Talsohle. Um zwei Höfe rechtwinklig gruppierte Bauten. Kirche an der Nordseite, im Kern auf das 13. Jh. zurückgehend. Schlichtes Äußeres mit Rundbogenfries auf Konsolen. Langrechteckiges Schiff mit dreiseitigem Schluss und (nachträglich vergrößerten) seitlichen Rundbogenfenstern. In der Westwand eine Dreifenstergruppe mit Maßwerk. An der Südseite ehemals ein gotisches Seitenschiff. Flacher Anbau mit zwei Maßwerkfenstern. Achtseitiger kleiner Dachreiter mit Haube. Inneres im wesentlichen nach 1925 mit flacher Balkendecke neu gestaltet. Epitaph für Äbtissin Barbara Hess („Barbara Hessin von Ingelheim"), gestorben 1641, an der Nordwand. (Weiterere Grabmale für die Äbtissinnen Kunigunde Klotz, †1606, und Ursula Jung, †1639, nicht erhalten.)
Ehemalige Klostergebäude weitgehend erneuert oder neu errichtet. Bruchsteinmauerwerk verputzt, Werkstücke aus Rotsandstein. Südtrakt des Westflügels dreigeschossig mit modernem Mansarddach. Bauinschrift mit Initialen der Äbtissin Ursula Jung und Jahreszahl 1617 auf einer Sandsteintafel an der östlichen Stirnwand. Ein rundbogiger Kellereingang mit Jahreszahl 1660. Von vasengekrönten Pilastern flankiertes Portal, die Öffnung mit Ohrenumrahmung. Über dem ovalen Oberlicht geschweifter Aufsatz mit Wappenkartusche und Jahreszahl 1752. Die Fenster schlicht rechteckig. Auf einem niedrigeren Verbindungstrakt zwischen den Hauptgebäuden hierher versetztes Sandsteingehäuse mit Muschelnische, darin Figur des hl. Bernhard, 18. Jh. Hofseitig in den Außenwänden vermauerte Wappenkartuschen der Äbtissin Anna Kreppelin, datiert 1750 und 1753. An einem modernen Bauteil Hl. Josef, 19. Jh. Innen geräumiges Treppenhaus (umgestaltet) mit breiter, einläufiger Steintreppe. „Zwei Räume mit Stuckdecken mit Rocaillen, 1750, wohl von Mainzer Künstlern" (Inv. 1965) nicht mehr auffindbar, vielleicht schon durch Brand von 1915 zerstört oder später verdeckt. Ummauerung des Friedhofes, gleichzeitig Klostermauer, in Teilen erhalten. Moderne Gestaltung der Außenanlagen. Nach Zerstörungen, Nutzungsänderungen, Modernisierung und Errichtung von Neubauten nüchtern wirkender Komplex, dessen ins Mittelalter zurückreichende Geschichte und Bedeutung sich nur aus genauerer Betrachtung der historischen Reste erschließt.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |