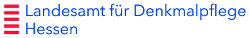Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Klunkhardshof 1
Teil der Gesamtanlage:
Altstadt Rüdesheim
Die Entstehungsgeschichte des kurz nach 1450 (1451, 1452 d) entstandenen, repräsentativen Fachwerkgebäudes ist nicht geklärt; fraglich ist die Errichtung durch die angesehene Rüdesheimer Familie Klunkhard, der u. a. ein Abt des Klosters Eberbach, ein Oberschultheiß und weitere geistliche und weltliche Würdenträger angehörten. Bauherren waren möglicherweise die zuletzt mit der Vorderburg begüterten Junker Brömser. 1684 wurde ein benachbartes Haus in der Hell für Johannes Klunkhard umgebaut. Zu diesem nicht erhaltenen Hof gehörten die Häuser Nr. 2 und 3 sowie weitere Nebengebäude. Bis um 1740 war das Haus im Besitz der Familie Klunkhard. Die Grundbezeichnung Klunckhartshof existiert erst seit 1760, der Gassenname lautete im 16. Jh. nach alter Flurbezeichnung In den Hellen, vor 1780 die Hölle. Das Fachwerkgebäude wurde bis um 1780 Haus zum Loch genannt nach dem öffentlichem Durchgang zwischen Marktplatz und damaliger Schützengasse (Löhrstraße). 1913 erfolgte die Freilegung des vorher verputzten Fachwerks.
Stattliches dreigeschossiges Wohngebäude auf leicht gekrümmtem, langrechteckigem Grundriss, der sich an die älteste Stadtmauer bzw. den ehemaligen Mauerring der Vorderburg anlehnt. Über massivem Sockelgeschoss ein Fachwerkgeschoss geringer Höhe, das ander Ostseite ursprünglich als Laubengang ausgebildet war. Darüber das Hauptwohngeschoss mit hohem, steilem, verschiefertem Satteldach zwischen Schildgiebeln. Dieses wird äußerst markant durchbrochen von drei ebenfalls vorkragenden Zwerchhäusern mit steilen Walmdächern, deren mittleres den Fassadenknick in umgekehrter Form aufnimmt. Der Überstand ruht auf einer gebogenen Knagge über profiliertem, mit einem Schnitzkopf versehenen Pilaster. Stark dimensioniertes Fachwerk aus gekrümmten, überblatteten Streben mit friesartig gereihten, gebogenen Brüstungshölzern. Fensteröffnungen verändert. Westseite entsprechend, jedoch verputzt, die Zwerchhäuser verschiefert. Am Südende spitzbogiger Straßendurchgang in Höhe des Sockelgeschosses.
Das Innere war bereits Ende des 19. Jh. oder früher in Einzelwohnungen aufgeteilt. Von der alten Ausstattung erhalten ist die handwerklich hervorragend gearbeitete hölzerne Wendeltreppe aus Holz auf runder, mit durchbrochenen Ornamenten geschnitzter Spindel mit Geländer aus gedrehten Docken. Zwei in der Literatur beschriebene, vergleichbare Treppen (im Hotel Rheinstein, Rheinstraße, und im Haus Corvers am Marktplatz) sind nicht erhalten (vergl. auch Treppe in Lorch, Wisperstraße 18). Eine profilierte Saalstütze mit Unterzug jetzt teilweise eingebaut. Weitgehend original erhaltener Dachstuhl.
Seltenes und hochwertiges Beispiel eines noch ganz spätgotischer Tradition verhafteten Wohnhauses von völlig eigenständiger Ausprägung. Neben dem Turm des Brömserhofes (Oberstraße) wichtigster spätmittelalterlicher Fachwerkbau des Rheingaus.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |