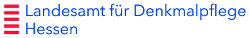Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Oberstraße 27
- Oberstraße 29
Teil der Gesamtanlage:
Altstadt Rüdesheim
Sitz der Brömser von Rüdesheim, die sich wahrscheinlich im 13. Jh. vom Hauptstamm derer von Rüdesheim mit dem Lilienwappen trennten und 1668 mit dem 1646 in den Freiherrnstand erhobenen Heinrich Brömser ausstarben.
Lage am nördlichen Stadtrand in einer Reihe weiterer Adelshöfe in der Oberstraße. Ehemals ausgedehnter, in mehreren Phasen seit dem 13. Jh. bis um 1650/52 entstandener Komplex. „Seitdem die Brömserschen Erben den Hof aufgegeben und verkauft haben, der dann seiner einstigen kostbaren Ausstattung entkleidet und als Bierkneipe, Schusterwerkstatt, Armenasyl, Waisenhaus, Handwerksburschenherberge, Landstreicherinternat und Leichenhalle unbekannter Ertrunkener im 19. Jh. die mannigfachsten Schicksale erlebt hat, ist das Äußere und Innere entstellt, zumal eine rohe Mauer den Hof durchschneidet, um den Besitz der Stadt am Brömserhof, die hier eine Schule untergebracht hat, von dem einer Familie zu trennen." (Klapheck 1929). 1944 Zerstörung des nordöstlichen Gebäudeteils mit dem zum ehemaligen Kronberger Haus überleitenden Treppenturm. Danach Aufteilung des in städtischem Besitz stehenden Nord- und Westflügels in Kleinwohnungen, Abbruch des Südosttraktes und störender Neubau eines modernen Wohnhauses in der Nordostecke (Oberstraße 31). Der restliche Hof jetzt als Museum (Mechanisches Musikkabinett) in Privathand. Zum ehemaligen Ostflügel Mang''sches Haus siehe dort (Oberstraße 33).
Die bisher publizierte Einordnung der Gebäude und ihre Entstehungsgeschichte muss nach jüngsten Erkenntnissen revidiert werden. Der zentral am nördlichen Hofrand gelegene Hauptbau, ein traufständiger, langrechteckiger, zweigeschossiger Massivbau von neun (ursprünglich zehn oder mehr) Achsen, zeigt in seinen mittig über dem Eingang auf Konsolsteinen auskragenden Erker mit Haubendach die Bauinschrift: H(einrich) B(römser) V(on) R(üdesheim) M(aria) M(agdalena) V(on) H(eddesdorf) / AN(N)O 1650 mit Allianzwappen Brömser von Rüdesheim/Heddesdorf. Jedoch konnte die fast vollständige Dachkonstruktion (Kehlbalkendach) auf 1292/93 (d) datiert werden; damit handelt es sich hier wahrscheinlich um den ältesten, 1650 durchgreifend umgestalteten Kernbau. In dessen Nordwand, wohl ehemals Stadtmauer, ein eingestellter, jetzt ganz eingebauter Treppenturm, im Erdgeschoss quadratisch mit vielleicht nachträglich eingefügter, von Gewölben überspannter dreiläufiger Treppe, darüber als Wendeltreppe bis ins Dach führend. In den ehemals stuckierten Innenräumen dieses Gebäudes keine Ausstattung; nur im Erker ein Sterngewölbe auf Maskenkonsolen. Unter dem Hauptbau großer, tonnengewölbter Keller.
Nördlich davon der bisher als mittelalterlicher Kernbau mit Entstehung im 13.-15. Jh. angesehene, tatsächlich jedoch nachträglich angebaute spätgotische Nordflügel, der sich durch reiche künstlerische Ausgestaltung aus der Bauzeit auszeichnet. Parallel zum Hauptbau gestellter Rechteckbau mit Satteldach und ähnlichem Schildgiebel an der Westseite. Dachstuhl (liegender Stuhl mit Überblattungen) um 1550 (1544-49 d). Innenräume: Über kellerartigen, gewölbten Räumen im hangseitigen Erdgeschoss Hauptgeschoss mit repräsentativer Raumfolge. Langrechteckiger Raum mit anstoßendem kleinem Raum, beide tonnengewölbt; vielleicht ehemalige Sakristei. In der Mitte vermutlich die ehemalige Hauskapelle, zweijochig mit gratigem Kreuzgewölben und gekuppeltem Recheckfenster. Von hier durch eine Rundbogentür zugänglich der östlich davon gelegene sog. Ahnensaal mit Sterngewölbe auf gekehlten Rippen und dreiteiligem Fenster mit Vorhangbogen. Die Haupträume sind mit flächendeckender Malerei an Wänden und Gewölben überzogen, die eine große Vielfalt architekonischer, ornamentaler wie auch figürlicher Motive zeigt, darunter Wappen, Tiere, Jagdszenen, biblische Motive und Rankenwerk. Im Ahnensaal Jonas-Szenen und eine Stadtansicht von Mainz; in den Gewölbekappen 32 Wappen des Familienstammes. Die Signatur I.R.V.W.M. mit Jahreszahl 1559 steht vielleicht für „Johannes Ritter von Wetzlar, Maler" und wird zugeschrieben Hans Ritter gen. Döring, um 1550 Hofmaler am Schloss Dillenburg. Die Malerei war schon nach Inv. 1965 „leider schlecht erhalten und vom Untergang bedroht". Als weitere Einzelheiten der Inneneinrichtung sind u. a. bemalte Türen, ein Wandschrank und ornamentierte Bodenfliesen aus Ton erhalten.
Östlich anschließend winkelförmige Anbauten um einen kleinen quadratischen Innenhof; hier u. a. datierter Türsturz mit Jahreszahl 1590.
An der Südwestecke des Haupbaues angestellter dreistöckiger Fachwerkturm mit hohem Spitzhelm und vier auf Streben auskragenden Wichhäuschen. Das Fachwerk teilweise im 18. Jh. verändert, im vorkragenden Obergeschoss durch Bretter überblendet. Die über zwei Geschosse massive Westwand war vielleicht ein Bestandteil der ehemaligen Stadtmauer. Die Entstehung des Turmes geht vermutlich auf das frühe 15. Jh. (1416 d) zurück, damit einer der ältesten bisher bekannten Fachwerkbauten des Rheingaus.
An den Turm westlich anstoßend massiver, aus drei rechtwinklig zusammenstehenden Teilen bestehender, schlichter Südwestflügel mit Rechteckfenstern in einfachen Sandsteingewänden, entstanden um 1650-52. Moderner Ausbau nach Entfernung des Gewölbekellers.
Nach 1965 abgebrochen: Stattliches Tor als Eingang von der Oberstraße aus regelmäßigem Quadermauerwerk mit flachem Bogen und geradem Abschluss, im Scheitel Allianzwappen Brömser-Heddesdorf, mit Jahreszahl 1652. Daran anschließender Südflügel vom Ende des 17. Jhs., der mit seinem Nebengebäude den Eingang zum Ostflügel überbaute. Über einem der Straßenkrümmung folgenden Grundriss massives Erdgeschoss und Obergeschoss aus verputztem Fachwerk; steilhohes verschiefertes Walmdach, Tür mit Ohrenumrahmung.
Im Hof der Rest eines Ziehbrunnens um 1610. Gebälk auf zwei mit Rosetten ornamentierten Pfeilern, Fries mit Löwenköpfen und Rosette, Rundmedaillon mit Allianzwappen Brömser-Kronberg zwischen Voluten (nach Inv. 1965).
Trotz des Verlustes wichtiger Bestandteile bau- und stadtgeschichtlich sowie künstlerisch herausragendes Beispiel eines bis in das Mittelalter zurückreichenden Adelshofes. Der Hauptbau gehört zu den ältesten Wohnbauten der Region. Der markante, wohl hauptsächlich aus Repräsentationsgründen errichtete Turm besitzt eigenständigen Wert als exemplarisches Beispiel spätmittelalterlichen Fachwerkbaus. Bedauerlich die heutige optische Ausgrenzung des ehemals zugehörigen Mang''schen Hauses, die Ausparzellierung und beziehungslose Neubebauung der Nordostecke sowie der fehlende räumliche Abschluss zur Oberstraße, wodurch die vielfältige und reiche Hofanlage in ihrer früheren Gesamtheit nicht mehr erlebbar ist.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |