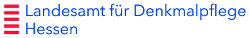Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Marienthaler Straße 3
- Marienthaler Straße 5
- Im Kiesel
Winkelförmiger Gebäudekomplex am westlichen Ortsausgang. Das 1148 als Augustiner-Doppelkloster gegründete, 1156 als Benediktinerinnenkloster durch die hl. Hildegard übernommene Kloster wurde nach dem 30jährigen Krieg weitgehend neu hergestellt. Der Aufbau der wohl urspünglich quadratischen Anlage erfolgte in drei Etappen: 1681-1683 grundlegende Renovierung von Kirche und Westflügel durch den Architekten Giovanni Angelo Barella, Mainz. 1737 Abbruch des Ostflügels und Neubau nach Plänen von Johann Valentin Thoman. 1747-1752 Errichtung von Stallungen, Scheune und Südflügel. 1803 Aufhebung des Klosters, 1816/17 Abbruch von West- und Südflügel, Nutzung von Kirche und Ostflügel als Zeughaus und Waffenlager. 1831 Verkauf an die Gemeinde und Einrichtung von Pfarrhaus und Rathaus mit Schule. Wiedereinweihung der Klosterkirche als Pfarrkirche. 1932 Zerstörung der Kirche durch Brand, dabei Verlust des aus der alten Pfarrkirche stammenden gotischen Taufsteins (Reste im Museum Brömserburg); Neubau bis 1935. Das ehemalige, durch Mauern begrenzte Klostergelände dient jetzt als Friedhof.
Kath. Pfarrkirche St. Hildegard
Erbaut 1934-35, Architekten: Gebr. Rummel, Frankfurt. Saalbau aus Ziegelmauerwerk mit hohem schiefergedeckten Satteldach und verschiefertem Dachreiter. Nach Osten ein Vorbau aus Muschelkalk für einen Außenaltar, darüber ein Rundfenster. An der Südostecke Hildegard-Statue aus Muschelkalk, 1957, Bildhauer: Franz Bernhard, Frankfurt/M. Türgewände mit Wappen der Äbtissin Magdalena Ursula von Sickingen und Datum 1685.
Innenraum mit tonnengewölbter Decke und Wandgliederung mit Blendarkaden.
Ausstattung bis 1961: sechs Glasfenster, Entwurf Hans Baur, Telgte/Westfalen. Altarbild, Wandmosaik nach einer Miniatur aus dem Scivias-Kodex (Schrift der hl. Hildegard). An der Südwand Kieselsteinmosaiken, Entwurf Ludwig Baur. Hildegardis-Schrein, 1929. Holzskulpturen Pietà, 16. Jh., und hl. Andreas, Ende 17. Jh. Jüngere Hildegard-Statue. Kreuzwegbilder von Franz Matheis, Frankfurt/M. Orgel, 1964.
Kath. Pfarrhaus
Ostflügel des ehemaligen Klosters von 1736-37, nach dem Brand von 1932 teilweise erneuert. Rechtwinklig von der Mitte des Kirchenschiffs ausgehender Anbau aus Bruchsteinmauerwerk mit verschiefertem Walmdach. Über 13 Achsen langgestreckter Bau, rechteckige Fenster in Sandsteingewänden. Zwei Eingänge mit Vordächern, über dem südlichen Wappenkartusche des Mainzer Kurfürsten Philipp Karl von Eltz und Chronogramm 1736.
Friedhofskreuz
auf dem Friedhof bei der Pfarrkirche. Kreuz und Korpus aus Sandstein, teilweise erneuert. Sockelinschrift 1709.
Kriegerdenkmal
für Gefallene des Krieges 1870/71. Obelisk aus Sandstein, darauf als Gussrelief Schwert mit Lorbeer. Sockelinschrift: „Sie starben den Heldentod fürs Vaterland 1870 im Vereinslazareth Eibingen."
Grabsteine
für Ordensfrauen, aus dem 18. Jh. stammend. Die Steine in Kreuzform mit Reliefverzierungen und Inschriften sind in die Friedhofsmauer eingelassen.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |