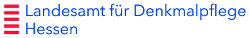Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Niddastraße 1
- Niddaplatz 2
- Niddastraße 1a
- Niddastraße 1b
Kurhaus, ehem. Volkshaus
Das Vilbeler Kurhaus wurde in den Jahren 1927/28 als Volkshaus errichtet. Der Bau wurde initiiert und durchgeführt von einer Gruppe Vilbeler Bürger, die dem örtlichen Arbeiterverein nahestanden. Zu den langwierigen Vorbereitungen gehörte die 1923 erfolgte Gründung einer GmbH als rechtsverbindlicher Bauträger und Betreiber. Trotz deren Nähe zur organisierten Arbeiterschaft war es das Ziel, eine allen Bevölkerungsschichten offenstehende Begegnungsstätte zu schaffen. Ganz in diesem Sinne fiel die Zustimmung des Gemeinderats zum Volkshaus-Baugesuch am 21.4.1927 einstimmig aus. Architekten des Bauvorhabens waren Beppler und Müller aus Frankfurt, die siegreich aus einem Wettbewerb hervorgingen. Nach ihrem Entwurf wurde das Volkshaus auf der rechten Niddaseite am Anfang der nach dem Vilbeler Fluß benannten Straße ausgeführt. Im Erdgeschoß befanden sich kleine Säle sowie ein Restaurant, im Obergeschoß der große Fest- und Turnsaal. Der Grundriß ist längsrechtekig, das über ihm aufgeschlagene Walmdach auf der Westseite etwas eingezogen, so daß der Eindruck einer dreiflügeligen Anlage entsteht. Er wird im Aufriß der nach Osten gelegenen Hauptseite fortgeführt durch den Kontrast von geschlossenen Seitentrakten mit dem mittleren Saalabschnitt, der von vertikalen Fensterbändern intensiv belichtet wird. Die Bauweise ist insgesamt als konservativ-konventionell zu beurteilen, ein Sachverhalt, der vermutlich auch in einem hohen Selbsthilfe-Anteil beim Bau des Volkshauses seinen Grund hatte.
Trotz der umfangreichen Eigenleistung der Bauherren war deren Verschuldung hoch, um die verbleibende Bausumme aufzubringen. Die allgemeine Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre bewirkte, daß der Umsatz des Volkshauses nicht den erforderlichen Umfang hatte, seinen Unterhalt zu finanzieren. Nach dem Konkurs der betreibenden GmbH übernahm die Stadt Vilbel das Volkshaus als öffentliche Einrichtung. Zur Verbesserung der Einnahmesituation wurde auch die Verabreichung von Heilbädern vorgesehen. Zunächst war dafür die entsprechende Umgestaltung der Kellerräume des Volkshauses geplant, dann wurde sogar ein eigener Anbau dieser Zweckbestimmung errichtet. Es wurde schließlich im Mai 1933, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, als Realisierung eines schon älteren Vorschlags in „Kurhaus" umbenannt. Es erhielt in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg die Funktion eines Bürgerhauses mit angegliedertem Badebetrieb, der eine Fülle von Umbauten nach sich zog. Im Äußeren blieb dabei die Grundanlage des alten „Volkshauses" mit der nach Osten gerichteten Schauseite und dem sich davor längs der Nidda ausdehnenden kleinen Park unverändert erhalten.
Park
Die Anlage eines kleinen Parks in den Jahren 1931-33 anstelle der früheren Bleichwiesen sollte die Umgebung des Volkshauses verschönern. Die Planungen hierzu gehen auf Philipp Siesmayer zurück, dessen realisierte Entwurfszeichnung auf den November 1933 datiert. Das Gelände wurde mit Beständen der Siesmayerschen Baumschule bepflanzt. Der Park erstreckte sich vermutlich ursprünglich von der Vilbeler Eisenbahnbrücke bis zur Brücke bei der Wasserburg und erhielt über diese Länge am Flußufer eine inzwischen wieder beseitigt Pappelreihe als begleitenden Saum. Heute bildet sich der Park als landschaftlich verstandenen Wiesenraum zwischen Kurhaus und Ehrenmal aus. Er ist sehr vielfältig gefasst und gewinnt durch einen von Weiden umstandenen Teich vor dem Kurhaus zusätzlich an Tiefe. Das Gelände entfaltet hauptsächlich eine Binnenwirkung, prägt längs der Nidda aber auch einen größeren Stadtraum.
Ehrenmal
Am nordöstlichen Ende der Grünanlage befindet sich ein Denkmal zu Ehren der Opfer des Ersten Weltkrieges. Die 1934 errichtete Anlage bildet den optischen Abschluss des Parks und wurde in den Entwurf Philipp Siesmayers mit nur wenigen Abänderungen des Bestandes eingepasst.
Der Ehrenmalsentwurf des Frankfurter Bildhauers Paul Seiler besteht aus einem Mauerzug mit zentraler halbrunder Nische und Treppenstufen aus behauenen Vilbeler Sandsteinen sowie einer im Halbrund positionierten zwölf Meter hohen Stele aus Taunussandgestein. Sie stellt das Zentrum der Anlage dar und ist mit einer eisernen Kugel mit aufgesetztem Eiserne Kreuz bekrönt. Die Stele zeigt vier Relieftafeln, von denen zwei je drei marschierende Soldaten in Uniformen mit Gewehren darstellen. Die dritte Tafel nimmt das Vilbeler Stadtwappen mit dem Schriftzug "Die Stadt Vilbel Ihren Gefallenen Söhnen" auf und die vierte trägt die Inschrift „Den gefallenen Helden Ehre und Dank". Am Mauerzug befinden sich vier Tafeln, die die Namen der Gefallenen aufnehmen. Eine zentrale fünfte Tafel mit Hakenkreuz und dem Text: „Den von 1919 bis 1933 für Deutschlands Freiheit und Auferstehung gefallenen Helden in Ehrfurcht gewidmet" ist nicht mehr erhalten. Ebenso abgängig sind zwei Feuerschalen. Vor der Anlage entstand außerdem ein mit Kies und Schlacken belegter „Festplatz“. Das Denkmal wurde weitgehend über private Spenden finanziert und am 21. und 22. Juli 1934 eingeweiht.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |