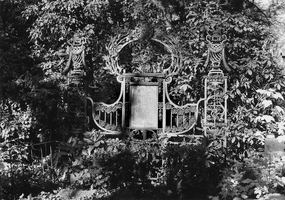Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Friedhofstraße 21
- Friedhofstraße
Text von Christina Uslular-Thiele
Der alte Friedhof war bereits Offenbachs dritte Begräbnisstätte. Der älteste Kirchhof bei der Schlosskirche ist nur durch Bodenfunde nachweisbar. Um 1700 legte man einen Friedhof außerhalb des Ortes vor dem Hanauer Tor an. Als die Bebauung nach Niederlegung des Tores fortschritt, entschloss sich die Kommune 1828 einen neuen, größeren Friedhof östlich auf freiem Gelände zu planen. Dessen ummauertes Areal durchzieht mittig ein Hauptweg in Verlängerung des Zugangsweges von der Stadt in West-Ostrichtung. Ein Querweg teilt die Fläche in vier etwa gleich-große Kompartimente. Weitere Hauptwege verlaufen innen parallel zu den Außenmauern. Wer den Plan für diese Anlage vorlegte, ist unbekannt, vermutlich hatte der Geometer, Bausachverständige und Kommunalpolitiker Jonas Budden entscheidenden Anteil. 1832 Eröffnung des neuen städtischen Friedhofs mit Versteigerung von 50 Erbbegräbnissen entlang der Mauer. Auf den Bau einer Kapelle wurde zunächst verzichtet. Erst 1843 errichtete man eine gedeckte Halle für Aufbahrungen. 1860 wurde der Friedhof um mehr als das Doppelte nach Osten verlängert und nach dem Vorbild des älteren Teiles gestaltet. Die beiden östlichsten Felder sah man, nur durch einen Weg abgeteilt, als künftigen jüdischen Friedhof vor. Denn auch den seit 1708 bestehenden jüdischen Friedhof an der Bismarckstraße hatte die fortschreitende Bebauung mittlerweile erreicht. Nach der endgültigen Schließung des älteren christlichen Friedhofs und dessen Umwandlung zum Wilhelmsplatz ließen Familien wie Metzler oder d'Orville ihre Grabmäler auf den Erweiterungsteil umsetzen. 1860 überführte man ehemals in der Fürstengruft der Schlosskirche beigesetzte Verstorbene der Isenburger Fürstenfamilie in eine neu angelegte Gruft an der Zwischenmauer. 1872/73 translozierte auch die jüdische Gemeinde Grablegen und stellte alte Grabsteine vor der östlichen Außenmauer auf.
Die heutige Eingangssituation mit zwei Kopfbauten beidseits des Haupttores wurde erst 1882/83 mit dem Bau der spätklassizistischen Verwaltungs- und Wohngebäude durch Stadtbaumeister Raupp geschaffen. 1888 kam eine halboffene Leichenhalle dazu. Von Oberbürgermeister Brink gefördert und vom Frankfurter Verein für Feuerbestattung unterstützt, wurde 1891/92 eines der ersten Krematorien Deutschlands errichtet. Angefeindet von klerikalen und konservativen Kräften konnte es allerdings erst 1899 genehmigt und in Betrieb genommen werden. Das Krematorium ist nicht erhalten, Türen der Öfen wurden an der Mauer zur Mühlheimer Straße angebracht. Das starke Bevölkerungswachstum machte in den 1880er Jahren eine Erweiterung des Friedhofsgeländes nun nach Süden notwendig. Ab 1906 wurde die westliche Erweiterungsfläche nach Vorgaben des Gartenbaudirektors Tutenberg parkartig umgestaltet. Einige der hier stehenden Grabdenkmale, wie das von Kohl-Roos, wirken trotz der Gedrängtheit der Steine wie Gartenplastiken zwischen Hecken und Bäumen. An den um das größere Rondell gruppierten Grabmälern lassen sich alle Varianten der großen, portalartigen Ädikulen des Neuklassizismus vor und nach dem Ersten Weltkrieg studieren. 1911 erfolgte ein Umbau der Versammlungs- und Leichenhalle mit Portalschmuck in den Formen des späten Jugendstils sowie des Neuklassizismus. Obwohl seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Anlage eines neuen Friedhofs vorgesehen war, verhinderten die Wirtschaftsprobleme der Zwischenkriegszeit bis 1939 dessen Eröffnung. Erst in den letzten Jahrzehnten verminderte eine zeitweise Schließung des alten Friedhofs den Nutzungsdruck. So blieben Grabanlagen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in bemerkenswerter Vielfalt erhalten. Seit 1998 sind wieder Urnenbeisetzung möglich und ein 2002 vorgelegtes Entwicklungskonzept ist die künftige Grundlage für eine sukzessive Wiederherstellung historischer Bepflanzungen und Denkanstoß für den angemessenen Umgang mit diesem Ort des Gedenkens und Erinnerns in den kommenden Jahrzehnten.
Von den Grabdenkmälern des 19. Jahrhunderts haben vor allem jene überdauert, die aus haltbarem Material gefertigten waren und denen Familientradition und Erbgrabstatus Schutz boten. Seit den Zeiten des Klassizismus galt weißer Marmor als edelster Werkstein, daneben waren heller sowie roter Sandstein bis in die Jahre um 1870 geschätzte Materialien. Von den eisernen Grabkreuzen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind nur einzelne wie das für Johanna Dejonge erhalten. Bei der Gestaltung früher Grabanlagen lassen sich mehrere Tendenzen beobachten: Die eine, bewusst schlichte in reformierter Tradition, beschränkte sich auf eine einfache, an der Mauer angebrachte Steintafel mit dem Familiennamen sowie niederen, oft pultartigen Steinen für die jeweiligen Beisetzungen, z.B. das ältere Familiengrab Boehm. Prestigeträchtig ist vor allem die Lage des Erbbegräbnisses. Eine andere bevorzugte stattliche, mehr oder minder künstlerisch gestaltete Grabsteine in unterschiedlichsten Formen und achtete auf Repräsentation durch wertvolle Materialien und ein respektgebietendes Erscheinungsbild, z.B. das Familiengrab Oehler. Konforme übernahmen standardisierter Vorbilder führten dazu, dass bestimmte Typen, z.B. die in den 1870er Jahren beliebten Ädikula-Grabstelen des Historismus bzw. der Neorenaissance in beachtlicher Vielfalt erhalten sind. Vergleichbares lässt sich ab 1900 bei den portalartig großen Ädikulen des Neuklassizismus beobachten. Seltener sind individuelle Gestaltungslösungen wie z.B das Grabmal der Familien Merte und Herrmann V., mit dem portraithaft wirkenden Relief des Wiedersehens der Verstorbenen. Von allen Konventionen der Sepulkralkunst scheint das Spicharzsche Grab mit der lebensgroßen Freiplastik eines Jagdhundes vor einem Baumstrunk abzuweichen. Doch lässt sich diese Skulptur auch als eine sehr individuelle Lösung innerhalb der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschätzten Darstellungsformen für Naturverbundenheit und -romantik ansehen. Zur Standardform, solche Vorstellungen symbolhaft auszudrücken, wurde der große Findling oder ein aus Felsbrocken geformter Berg, oft auch dargestellt durch Stelen mit grob behauener Oberfläche. Bei Betrachtung der Ikonographie der Grabmale des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Offenbach fällt auf, dass christliche Motive nicht dominierten, was wohl der liberal-freigeistigen Haltung des hiesigen Bürgertums zuzuschreiben ist. Zu beobachten sind vielfältige, damals allgemein verständliche Bildzeichen, die ohne konfessionellen Bezug auf die "letzten Dinge" anspielten, z.B. nach unten gekehrte Fackel, abgebrochene Säule. Auch die Vielfalt geflügelter Puttenköpfchen und Engelsfiguren besaß neben christlicher Sinngebung oft einen allgemein-sentimentalen Charakter. Bezeichnenderweise verschwanden die Engel Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Übergang vom Historismus zum Neuklassizismus und verwandelten sich in junge, antikisch gewandete Frauen, die nun als Symbole ewiger Trauer den Grabstein flankierten. Ebenfalls fällt auf, dass bereits früh ab den 1830er Jahren neogotische Formen auftauchen, während man für die Architektur im Offenbacher Stadtbild bis in die 1860er Jahre den Spätklassizismus als angemessen empfand. Dieser Wertschätzung lag die Vorstellung zugrunde, dass die Kunst des Mittelalters ein Ausdruck echter, vorbildhafter Frömmigkeit gewesen sei; Beispiele für solchen frühen Historismus sind die Denkmale Maria Magdalena d‘Orville sowie Familie Schmaltz.
Während im frühen 19. Jahrhundert Entwerfer und Steinmetzen unbekannt blieben, - Ausnahme ist das Wandgrab Kitzinger des Architekten Friedrich Simeons - sind aus der zweiten Jahrhunderthälfte etliche signierte, qualitätvolle Denkmäler von Steinmetzen und Bildhauern wie Jacob Weitbrecht, Adolph Steuerwald, Philipp Weber und anderen nachweisbar. Dies ist auch durch die Konkurrenzsituation zu erklären, denn im Zuge der allgemeinen Industrialisierung ersetzte bei der Herstellung von Grabdenkmalen maschinelle Produktion zunehmend handwerkliche Arbeit. Firmen wie Hofmeister aus Frankfurt oder WMF in Geislingen lieferten auch nach Offenbach glänzend polierten Hartstein, galvanisch hergestellte Bronzeappliken und Figuren, Marmorplastiken kamen vorgefertigt aus Italien. Was, wie z.B. beim Familiengrab Ermold, individuell wirken sollte, ist die Marmorvariante eines beliebten Vorbilds, geschaffen von einem anonymen Künstler; eine galvanoplastische Replik der Frauenskulptur befindet sich beim Grabmal J. P. Leonhardt. Neben der seriellen Gefälligkeit solcher Figuren konnte ein Werk wie das von Carl Cauer, Mitglied einer bekannten deutschen Künstlerfamilie, für den Lithographen und Maler Georg Schmidt nur in Kenneraugen seine Wirkung entfalten. Nicht nur durch den wirtschaftlichen Aufschwung zu neuem Wohlstand gekommene Familien investierten in repräsentative Gräber, auch altrenommierte ersetzten und ergänzten klassizistische Anlagen durch Prachtgräber im Stile des späten Historismus. Statt des roten Sandsteins wurde Ende des 19. Jahrhunderts glatter dunkler Granit als Ausdruck tiefer Trauer zum geschätzten Material.
Mit einer Zeitverzögerung machten auch die Gräber der jüdischen Gemeinde diese Entwicklung mit. Bis zum Jahrhundertende bestand mehrheitlich das traditionelle Typenrepertoir mit flachen Stelen aus rotem Sandstein in modifizierten spätklassizistischen Formen. Dadurch entstand in den beiden jüdischen Grabfeldern ein Ensemble von großer formaler Geschlossenheit, in dem sehr schlichte Steine und künstlerisch höchst anspruchsvolle, wie die der Eheleute Merzbach, nebeneinander stehen und bestehen können. Erst nach 1900 übernahmen auch jüdische Auftraggeber die zu diesem Zeitpunkt allgemein üblichen, repräsentativen Formen und Materialien, z. B. das Grab der Familie Carl Stern. Außer in der Beschriftung gab es seit dem frühen 20. Jahrhundert kaum mehr sichtbare Unterschiede zu christlichen Grabdenkmälern, doch verzichtete man weiterhin aus religiösen Gründen auf figürliche Motive. Einzige Ausnahme vom Bilderverbot ist das große, singuläre Grabmal des späten Jugendstils von Heinrich Jobst in dominanter Lage für Offenbachs Ehrenbürger Ludo Mayer.
Ab 1908 setzte sich der Direktor der Kunstgewerbeschule und Architekt Hugo Eberhardt gemeinsam mit Lehrern wie Bildhauer Karl Huber und Architekt Dominikus Böhm für eine Erneuerung der Grabmalskunst im Sinne der ästhetischen Reformbewegung ein. In Abwendung vom Historismus plädierten sie für individuell gestaltete Grabmäler. Zweifellos gehören heute die von Eberhardt entworfenen Denkmäler Mausoleum Krumm, die Grabanlagen Weintraud, Feistmann sowie das jüngere Familiengrab Boehm zu den bedeutendsten Kunstwerken auf dem alten Friedhof. In ihnen verbinden sich Stilelemente des späten Jugendstils mit denen des Neuklassizismus, der sich zwar auch aus dem Formenschatz der Antike bediente, jedoch sehr frei mit Dekor- und Bauformen umgeht und diese vereinfacht. Das von Eberhardt geschätzte Baumaterial Muschelkalk unterstützte diese Tendenz zu Formreduktion und Verschleifung besonders der dekorativen Details, wodurch der Eindruck des "Modernen" erzeugt wurde. Grabmale waren für Eberhardt Objekte der angewandten Kunst, in denen sich Architektur und Skulptur vereinten, deshalb arbeitete er immer eng mit ihm vertrauten Bildhauern wie Karl Huber und Karl Stock zusammen. Eigenständige Grabmäler dieser beiden Bildhauer sind nicht sicher feststellbar. Doch gibt es Beispiele, die von ihnen angeregt wurden oder aus dem Schülerkreis stammen, z.B. der Grabstein für Otto Beck. So zeigt eine Vielzahl schlichter Steine den Erfolg dieser Friedhofsreform speziell Offenbacher Prägung im Sinne von Einfachheit und künstlerischer Individualität innerhalb der Konventionen des Neuklassizismus. Andere, künstlerisch ambitionierte Varianten des Jugendstils wie das schmiedeeiserne Familiengrabmal Nilson sind Ausnahmen. Von den Aufträgen an den in Jugenheim tätigen Bildhauer Daniel Greiner, zeitweise auch Mitglied der Darmstädter Künstlerkolonie, sind noch die Grabmäler Roosen, Koch und Weth-Röder erhalten, die Stele Grundel wird ihm zugeschrieben. Künstlerentwürfe von Greiner und Heinrich Jobst, damals der Bildhauer der Darmstädter Künstlerkolonie, zeigen, wie sich in den Jahren um 1910 der Jugendstil in den Neuklassizismus als spezifisch bürgerlich empfundene Ausdrucksform verwandelte. Steinmetze wie Grabmalindustrie griffen dieses Formenrepertoire schnell auf, z.B. zu sehen an der Tempelfassade des Grabmals Huck gegenüber dem Haupteingang, allerdings konventionell mit sprödeharter Plastizität.
Auch im Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg lässt sich der fortwirkende Einfluss der Kunstgewerbeschule auf jüngere Steinmetze sowie deren Auftraggeber beobachten. Der Stilwandel zum Spätexpressionismus bzw. dem deutschen Art d'co sowie ab 1925 zur so genannten Neuen Sachlichkeit brachte eine bemerkenswerte Typenvielfalt hervor. Beispiele für individuelle Gestaltung sind die Steine für Sans, Brockmann und Klotz sowie Dominikus Böhms Entwurf für Mansmann. Bildhauer wie Ernst Unger und Steinmetze wie Viktor Quera sowie der Frankfurter Bildhauer Emil Hub mit seinen Gräbern für Kohl-Roos, Leo-Alt, Opel sowie Carl Stroh schufen Grabdenkmale, die aus dieser Zeit in vergleichbarer Qualität und Dichte nur selten auf anderen Großstadtfriedhöfen Deutschlands zu finden sind. Der Gedenkstein für den Maler Heiner Holz, dessen Relief nach einer seiner Zeichnungen geformt wurde, ist ein Unikat des poetischen Spätexpressionismus. Bei der Gestaltung von Inschriften und Schriftbildern wirkte sich die Tätigkeit der Offenbacher Schreiberschule um Rudolf Koch prägend aus, z.B beim Grabstein Schlegel. In den 1930er Jahren lassen Fantasie und Eigenwilligkeit bei der Formfindung nach. Durch die Zielsetzung der so genannten Neuen Sachlichkeit wurden einfache, kubische Formen zur Norm, dekorative Schmuckformen seltener. Zu den wenigen gelungenen Ausnahmen figürlich gestalteter Grabmälern aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg gehören das der Steinmetzfamilie Quera sowie das keramische Relief einer Grablegung auf dem Grabstein Daus. Nach dem Zweiten Weltkrieg trennten sich die Wege von Kunst und Grabsteinherstellung weitgehend.
Eigenständige Denkmale:
In einer Art Lapidarium wurden zum Teil stark verwitterte Stelen des Spätbarock, der so genannten Zopfzeit und des Klassizismus um die Grabpyramide des General Löw aufgestellt. An die Toten des Eisenbahnunglücks von 1900, von denen einige hier beigesetzt wurden, erinnert das vom Frankfurter Bildhauer Franz Krüger entworfene Denkmal. An der Stelle, wo sich Gräber von im Krieg 1870/71 gestorbenen Soldaten befanden, wurde 1957 das vorher auf dem Aliceplatz stehende Denkmal für die Gefallenen dieses Krieges umgesetzt. Nach Entfernung der schadhaften Skulptur einer Viktoria (Reste verwahrt das Haus der Stadtgeschichte) verblieb der Sockel des 1877/78 vom Offenbacher Bildhauer Josef Keller geschaffenen Denkmals. Zur Erinnerung an sechs Schulkinder, die 1906 an der Schleuse ertranken, wurde 1911 ein kleines Denkmal errichtet. Form und Ausführung wurden durch einen Wettbewerb unter Schülern des Bildhauers Karl Huber an der Kunstgewerbeschule ermittelt, den der Schüler Braun gewann. Eine Denkmalgruppe bilden das Gräberfeld der in Offenbacher Lazaretten verstorbenen Soldaten des Ersten Weltkriegs, das Ehrenmal für bei Betriebsunfällen während des Krieges umgekommene Mitarbeiter des Chemiebetriebs Griesheim Elektron und die beiden Denkmale für die Gefallenen des Turn- und des Sportvereins. Das Ehrenmal in Form eines oben offenen Tempels entwarf Hugo Eberhardt 1918 zusammen mit Karl Huber. Eberhardt nahm auch Anfang der 1920er Jahre Einfluss auf die einheitliche Neugestaltung des Reihengräberfeldes mit gedrungenen Steinen in Pultform, damit ein Charakteristikum Offenbacher Grabgestaltung aufgreifend. 1924 entstand das blockhafte Denkmal für die gefallenen Turner nach einem Modell des Offenbacher Bildhauers Ernst Unger. Ein weiteres Denkmal für die Weltkriegsgefallenen der jüdischen Gemeinde befindet sich im jüdischen Teil des Friedhofs an der Ostmauer. Das vom Architekten Karl Wagner zusammen mit dem Bildhauer Karl Stock entworfene Denkmal war Anfang der 1920er Jahre an der Fassade der Synagoge in der Goethestraße angebracht worden.
Offenbachs alter Friedhof ist ein Kulturdenkmal besonderer Qualität, dessen Grabmale ab dem Spätbarock einen Überblick über die Stil- und Kunstentwicklungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Rahmen der Sepulkralkultur geben. Gleichzeitig ist der alte Friedhof eine bedeutende Quelle zur Stadtgeschichte, da fast alle wichtigen Fabrikantenfamilien hier ihre Grabstätten hatten, und er ist ein geschützter Park und Naturdenkmal mit beachtlichem Artenreichtum an Bäumen und Gehölzen.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |