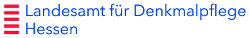Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
- Franziskanerstraße 4
- Franziskanerstraße 6
1941 aus Fertigbauteilen auf einem Tiefparterre aus Bruchsteinen errichtete Holzbaracke.
Geschichtliche Informationen
Die 1941 von der Firma Leitz auf einem städtischen Grundstück („Zur Weiherwiese“) errichtete Holzbaracke diente als Versorgungsgebäude. Auf einem Plan aus dem Jahr 1954 findet sich die Bezeichnung „K.H.D.-Baracke“ (KHD = Kriegshilfsdienst). Die Baracke wurde nach dem Krieg für andere Zwecke genutzt und 1992 vom Förderverein Kulturzentrum Wetzlar e. V. übernommen. Die letzte aktiv genutzte Baracke im Lahn-Dill-Kreis dient heute als Kulturzentrum mit Proberäumen für Bands im Tiefparterre und als Veranstaltungsort unterschiedlicher Gruppen und Vereine im Hochparterre.
Beschreibung und Analyse
Die Baracke wurde auf einem Tiefparterre aus Bruchsteinen mit Backsteingewänden an Tür- und Fensteröffnungen errichtet. Tür- und Fensterstürze des Tiefparterres wurden aus Beton gegossen. Die 20 cm dicke Kellerdecke besteht aus Stahlbeton mit Doppel-T-Trägern. Auf diese wurden die vorgefertigten Wandtafeln mit einheitlichen Maßen aufgesetzt. Die Tafeln bestehen aus 8 cm- Kanthölzern mit einer Pappe als Windschutz, Isoliermaterial sowie Nut-und-Feder-Brettern (H 300 cm / B 250 cm / T 12 cm). Die Außenseite der Wandtafeln besteht aus vertikalen Schalbrettern. Es finden sich drei Typen: Wandtafeln mit Tür- oder Fensteröffnungen sowie reine Wandtafeln. Die zweiflügeligen Holzfenster erhielten hochrechteckige zweiteilige Fenster, die mit hölzernen Klappläden komplett verschlossen werden konnten (Grund: Verdunkelung im Luftkrieg). Am Stoß werden die Wandtafeln durch ein weiteres Brett überdeckt, wodurch ein regelmäßiger Rhythmus entsteht, der das Gebäude als typisiertes Bauwerk erkennbar macht. Von großer Aussagekraft ist insbesondere die Südwand der Baracke, die ihr ursprüngliches Erscheinungsbild weitgehend ungestört bewahrt hat. Das Dachgespärre trägt ein niedriges Satteldach mit Teerpappe als Dachhaut. Bis auf einen Veranstaltungssaal wurde das Gespärre im Innern mit Heraklith-Platten als Deckenabschluss geschlossen.
Die weitgehend aus Fertigbauteilen errichtete Baracke entspricht kriegsbedingten Bautypen zur Unterbringung unterschiedlicher Gruppen. In ihnen wurden Wehrmachtssoldaten, Zwangsarbeiter, aber auch KZ-Häftlinge platz- und kostensparend untergebracht. Beispiele dieses Bautyps finden sich in der 1943 von Ernst Neufert publizierten Bauordnungslehre (BOL). Die Kriegszeit erforderte eine zeit- und materialsparende Bauweise, die auch für den Bau von Holzbaracken galt. Die Begründung lieferte Albert Speer bereits im ersten Satz seines Vorworts zur BOL: „Der Totale Krieg zwingt zur Konzentration aller Kräfte auch im Bauwesen.“ Neufert führt unterschiedliche Beispiele für BfH-Konstruktionen (BfH = Bevollmächtigte für Holzbau) in ein- und zweigeschossiger Bauweise sowie deren Ausstattung an (vgl. BOL, S. 317-327).
Veränderungen in späterer Zeit
Die ehemals holzsichtige Baracke ist straßenseitig in einem hellen Ockerton gestrichen, die Treppenaufgänge und Eingangstüren wurden erneuert. Die Baracke erhielt in den 1980/90er Jahren an ihrer Ostwand einen Anbau.
Begründung
Die Baracke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stellt ein wichtiges historisches Bauwerk der NS-Zeit in Wetzlar dar, insbesondere der Kriegsjahre 1939-45. Sie erinnert an die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft durch Zwangsdienste und die oftmals menschenunwürdige Unterbringung von Zwangsarbeitern und anderer Gruppen durch das nationalsozialistische Regime. Ihr ungewöhnlich guter Erhaltungszustand macht sie zu einer der bedeutendsten Holzbaracken aus dieser Zeit.
Die Baracke ist ein Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |