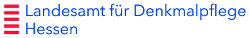Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!
Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.
Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.
























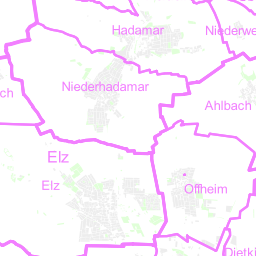
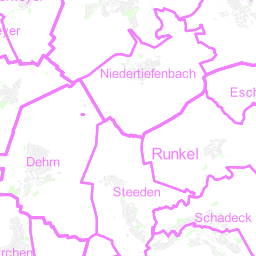


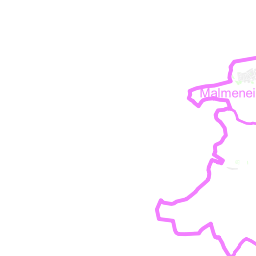
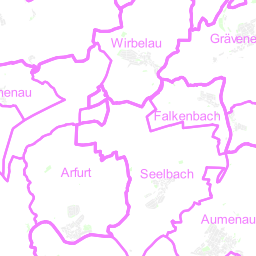


























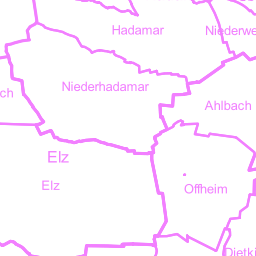
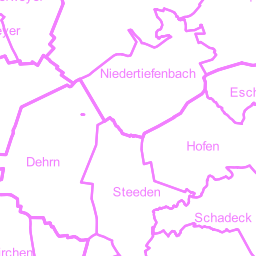


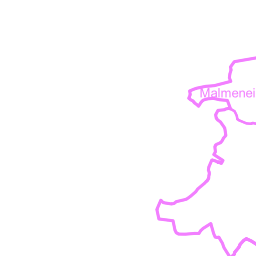
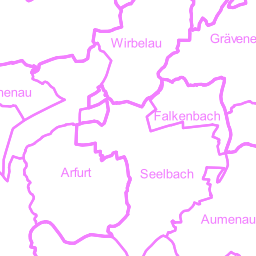


- Hüttenstraße
- Hütte
- Wilhelm-Passavant-Straße 14
Bedeutender, großflächiger Firmenkomplex der ehemaligen Michelbacher Hütte, später Passavant-Werke im Aartal, der sich zwischen Aartalbahn, Aar und der Einmündung des Aubachs unterhalb der Hänge des Hintertaunus ausbreitete.
Geschichte
Ab 1652 wurde im Auftrag des Grafen Johann von Nassau-Idstein in Michelbach, am Standort einer Mühle, eine erste Eisenhütte errichtet, die 1656 ihren Betrieb aufnahm. Produziert wurden Produkte des täglichen Gebrauchs, wie beispielsweise Öfen und Töpfe, aber auch Bau- und Schmiedeeisen zur Weiterverarbeitung. Nahe gelegene Erzlagerstätten, zum Beispiel die Grube Bonscheuer, lieferten die Rohstoffe und die umliegenden Wälder des Hintertaunus sicherten die Holzkohleherstellung für den hohen Energiebedarf der Eisenhütte. Ab 1688 wechselten die Pächter und später die Besitzer des Werkes mehrfach. Im Jahr 1885 verkaufte der damalige Besitzer, die Frankfurter Firma Oppenheim & Weill, das Werk an Adolph Samuel Passavant (1841-1926). Der Frankfurter Architekt und Unternehmer baute das Werk mit der Konzentration auf die Produktion von Kanalgusserzeugnissen erfolgreich aus. Der Ausbau der Aartalbahn bis 1894 und damit der Anschluss des Werkes unterstützte die Expansion. 1917 übernahm Sohn Wilhelm die Leitung des Werkes. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion auf Rüstungsgüter umgestellt. Nach dem Krieg nahm man die Herstellung von Kanalguss, aber auch von Entwässerungsanlagen, Baumaschinen, etc. wieder auf. Neben der Firma Buderus war Passavant jahrzehntelang Marktführer im Bereich der Abwassertechnik. 1950 stieg Udo Passavant in die Firmenleitung ein. 1988 Verkauf des Werkes an die Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft. 2000 Verkauf des Bereichs Entwässerungs- und Abscheidetechnik an ACO Passavant Detego GmbH.
Baubestand
Aus der Zeit vor der Übernahme durch Adolph Samuel Passavant 1885 sind lediglich das alte Verwaltungsgebäude und der Löschteich erhalten, der bereits vor der Gründung der Eisenhütte 1652 als Mühlteich bestand. Passavant ersetzte die Mehrzahl der historischen Gebäude im Laufe der Zeit durch Neubauten, davon zeugen mehrere Wohn-, Verwaltungs- und Produktionsbauten der Expansionszeit des Werkes bis in die 1950er Jahre.
Altes Verwaltungsgebäude der Michelbacher Hütte
Ehemaliges Verwaltungsgebäude der Michelbacher Hütte in beherrschender Lage über dem Werksareal. Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts mit jüngeren Veränderungen des Gefüges. Kleiner Dachreiter mit Haubenlaterne und Uhr. An der Giebel- und östlichen Traufseite abgerundetes Schwellholz, profiliertes Rähm. Haustür und Anbauten des 19. Jahrhunderts.
Villa Passavant
Villa mit Gartenpavillon, Garten und Einfriedung. Ehemalige Direktorenvilla des Firmengründers, erbaut 1890, mit nachfolgenden Um- und Anbauten verschiedener Epochen. Heutige Nutzung als Gästehaus und Schulungsgebäude. Komplex auf winkelförmigem Grundriss über ansteigendem Geländeniveau, oberhalb des angestauten ehemaligen Löschteiches. Jeweils unterschiedliche Erscheinung der Fassaden zur Hof- und Gartenseite mit neuklassizistischen und Jugendstil-Elementen. Im Inneren des Gästehauses ist in den Gesellschaftsräumen eine zeittypische und hochwertige Ausstattung der 1950er und 1960er Jahre erhalten. Der rückwärtige Garten und die Terrasse mit Natursteinbelag sind zeitgleich passend gestaltet. Der Vorgarten wird durch eine reich verzierte Einfriedung aus werkseigener Produktion abgeschlossen.
Ehemalige Direktorenwohnhäuser
Gruppe aus zwei Wohngebäuden unterschiedlicher Bauzeit. Das ältere, gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Gebäude in schmuckloser Fachwerkkonstruktion errichtet, daran anschließendes villenartiges Wohnhaus um 1930. Verputzter Kubus mit Walmdach und Segmenterker mit runden, gedrechselten Holzsäulen.
„Jahrhunderthalle“ (Gebäude 226)
Die Halle wurde 1913 als massiver Ziegelbau mit erhöhtem Mittelschiff errichtet und ist somit das älteste erhaltene Produktionsgebäude des Werkes. Sie liegt am westlichen Rand des Geländes, direkt an der Trasse der ehemaligen Aartalbahn. Der schlichte Bau wurde ursprünglich an der Südseite durch einen Schmuckgiebel akzentuiert, der zurzeit durch einen Anbau verdeckt wird. Das Innere zeigt als herausragendes Merkmal eine dreiseitige, stählerne Galerie mit verziertem Geländer, das aus der werkseigenen Produktion stammt. Oberhalb der filigran gestalteten Galerie ist die technische Besonderheit eines bauzeitlichen Schwerlastkranes erhalten. Die Decke über der Galerie ist als Kassettendecke in Beton mit Stahlträgern ausgebildet. Die Belichtung erfolgt über spitzgiebelige Oberlichter, die vermutlich in den 1950er Jahren erneuert wurden. Ein bauzeitliches Holzdach mit einem offenen, stählernen Dachstuhl überdeckt das Mittelschiff. Seitlich wird das Mittelschiff durch doppelte Stahlsprossenfenster belichtet, deren Mittelstützen durch Stahlprofile gebildet werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Halle nach Westen durch einen eingeschossigen Anbau erweitert. Dazu wurden die Fenster der ehemaligen Westwand der Halle entfernt und zeigen sich heute als segmentbogenförmige Öffnungen. Der Anbau wird durch hochrechteckige Stahlsprossenfenster belichtet. Die aufwendige architektonische Gestaltung und Wirkung im Inneren der Halle ist heute trotz moderner Einbauten noch erfahrbar.
Direktionsgebäude (Gebäude 235) und ehemalige Schweißerei (Gebäude 234)
Direkt am ehemaligen Löschteich steht das dreigeschossige Direktionsgebäude, das sich mit seinem abgewinkelten Grundriss der Form des Gewässers anpasst. In der für das Passavantwerk typischen Bauweise ist der Ziegelbau mit Zeltdach aus dem Jahr 1954 im Äußeren schlicht gehalten, in der inneren Ausstattung dagegen aufwendiger gestaltet. Die Betonsteine der Dachdeckung sind bauzeitlich und stammen aus werkseigener Produktion. Bei den Fenstern haben sich im Erdgeschoss teilweise Stahlsprossenfenster, im Obergeschoss teilweise Holzsprossenfenster aus der Bauzeit erhalten. Einige wurden später durch Aluminium- bzw. Kunststofffenster ersetzt. Der Haupteingangsbereich ist in Natursteinverblendung eingetieft konstruiert. Die messingfarbenen Glasfüllungstüren mit dunklen Steingewänden sind zeittypisch gestaltet. Im Eingangsbereich ist eine Schauvitrine mit messingfarbener Rahmung eingebaut. Repräsentativ gestaltet auch das Treppenhaus, hier korrespondieren die dunkel belegten Treppenstufen mit dem schwarzen Stahlgeländer und dem messingfarbenen Handlauf und den Zierkugeln. Belichtet wird das Treppenhaus durch Buntglasfenster in zarten Pastellfarben, die ebenfalls dem damaligen Zeitgeschmack entsprechen. Zudem sind weitere repräsentative Ausstattungstücke aus der Bauzeit erhalten, insbesondere in den zum Teich hin gelegenen Büroräumen, die teilweise über einen Balkon verfügen.
Zeitgleich mit dem Direktionsgebäude wurde südlich anschließend die eingeschossige Halle der Schweißerei in Stahlskelettbauweise mit Ziegelausmauerung errichtet. Das Satteldach in Stahlkonstruktion mit erneuerter Eindeckung. Prägend für den Bau sind die großen Stahlsprossenfenster, die teilweise noch das ursprüngliche Ornamentglas besitzen.
„Wilhelmsbau“ (Gebäude 215)
Der langgestreckte, abgewinkelte Produktionsbau im südlichen Teil des Werksgeländes ist in eine Reihung von Gebäuden aus der Zeit von 1939 bis 1976 eingebunden. Der dreigeschossige Betonskelettbau entstand 1955 und wird durch das Betonraster und die großflächigen Fensterbänder geprägt. Ursprünglich um eine Achse kürzer erbaut, wurde der Bau bereits 1956 um einen östlichen Anbau in angepassten Formen ergänzt. Dadurch ergibt sich die asymmetrische Form des Daches, das später durch ein modernes Stahldach erneuert wurde. Erhalten sind in weiten Teilen die großflächigen Stahlsprossenfenster mit Ornamentglas. Die später ausgetauschten Aluminiumfenster stören das einheitliche Raster der Fassade. Ursprünglich gehörte der „Wilhelmsbau“ zum Betonwerk und wird zurzeit als Lager und Werkstätte genutzt.
Begründung
Als Michelbacher Hütte ist die Anlage im Aartal das einzig erhaltene Zeugnis der einstmals zahlreichen Eisenverarbeitungsstätten im Taunus. Ihre historischen Produkte wie beispielsweise Brunnen sind heute noch zahlreich in der Umgebung vorhanden. Die Kanalschachtabdeckungen mit dem Firmennamen „Passavant“ sind bis heute europaweit in der gebauten Umgebung vielfach zu finden und bezeugen die überregionale Bedeutung des Werkes.
Die angesprochenen Gebäude, die Gartenanlage und der Löschteich sind herausragende, gut erhaltene Zeugnisse der langen Geschichte des bedeutenden Werkes. Sie dokumentieren diese Tradition mit frühen Verwaltungs- und Wohnbauten und Bauten der jüngeren Ausbauphasen des 20. Jahrhunderts. Die Architektur der Gebäude entspricht jeweils der typischen Gestaltung ihrer Entstehungszeit. Die Innenausstattung geht teilweise über den zeittypischen Standard hinaus und ist in vielen Fällen authentisch erhalten. Insbesondere in der Industriearchitektur ist dieser gehobene Standard von Seltenheitswert.
Die ausgewiesenen Gebäude, die Gartenanlage und der Löschteich sind daher aus geschichtlichen Gründen als Sachgesamtheit gemäß § 2 Abs. 1 HDSchG in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.
Legende:
| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |
| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |
 |
Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |
 |
Jüdischer Friedhof |
  |
Kleindenkmal, Bildstock |
 |
Grenzstein |
 |
Keller bzw. unterirdisches Objekt |
 |
Baum |